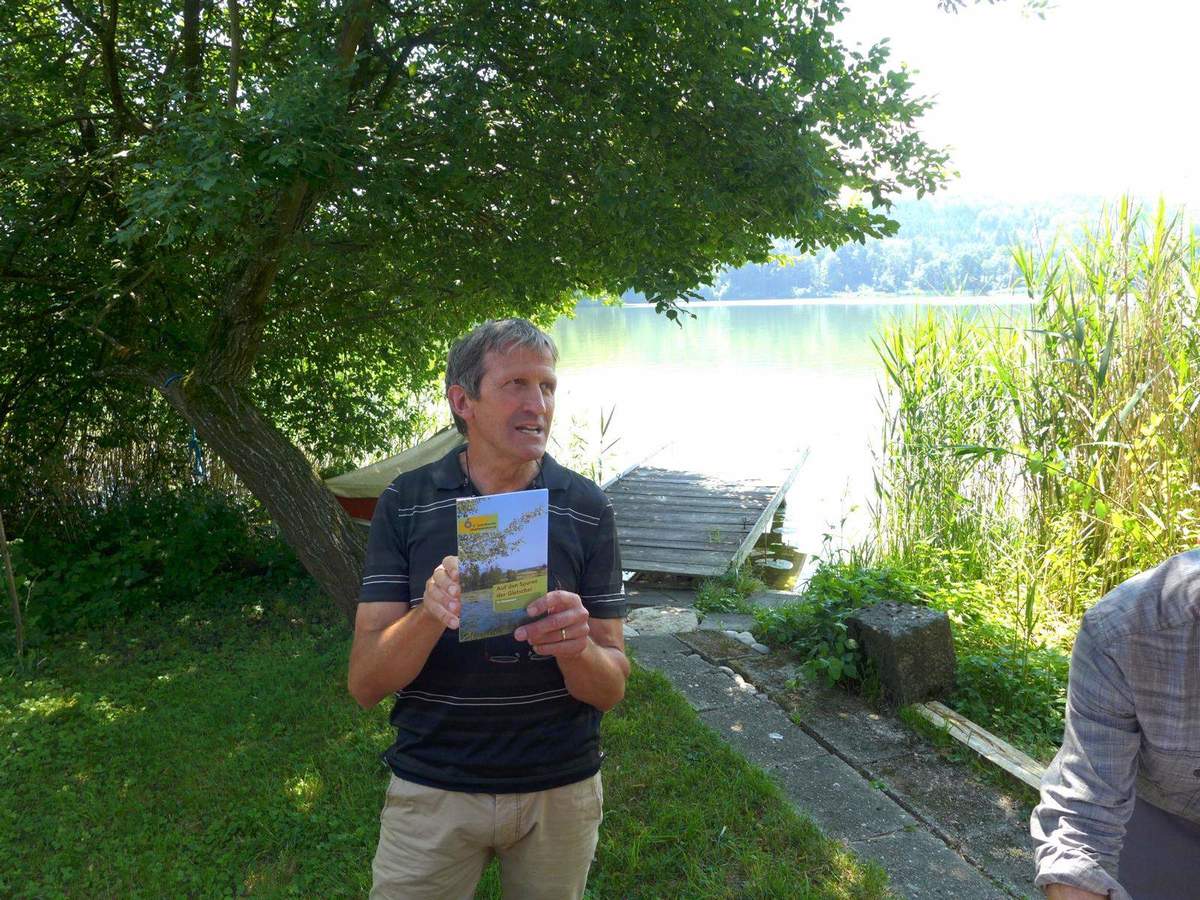14.08.2018
Bericht: Der Klimawandel und der Wald / Waldbegehung am Burgäschisee
Was hat Moorschutz mit dem Klimawandel zu tun?
Warum sind das Aeschi- und vor allem das Chlöpfibeerimoos so wichtig? Und was passiert mit dem Wald, wenn es wärmer wird? 2000-Watt-Region Solothurn lud zu einer vielseitigen Führung an den Burgaeschisee.
Wie viel kälter als in der Referenzzeit von 1960–1990 war es eigentlich in der Würmeiszeit vor 20’000Jahren? Damals reichten der Aare- und der Rhonegletscher bis Solothurn und Herzogenbuchsee. Sie hinterliessen Toteisbecken, aus denen der Inkwiler- und der Burgaeschisee mit Moorlandschaften entstanden. Das «Chlöpfibeerimoos» – letztes Hochmoor des Kantons Solothurn, zu dem es wie der Burgaeschisee zum grösseren Teil gehört; der Rest ist bernisch – steht unter Bundesschutz.
Das verpflichtete die beiden Kantone zur nachhaltigen Sanierung, um das Moor sowie seine seltenen Pflanzen, etwa das namengebende «Chlöpfibeeri» (Moosbeere) vor Verwaldung, Düngung und Austrocknung zu schützen, wie der Biologe und Raumplaner Thomas Schwaller vor rund zwei Dutzend Interessierten ausführte. Doch nicht nur dies. Nördlich des Sees wurde das Aeschimoos auf Staatsland regeneriert. Dies mit dem Ziel, den weiteren Torfabbau zu unterbinden und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern. Ein Feldweg wurde rekultiviert und stattdessen ein attraktiver Fussgängersteg aus Holz zwischen Erlenwäldchen und Dornackerbächlein gebaut. Wassergesättigter Torfboden vermag viel mehr CO2 zu binden als Ackerboden. Die Massnahmen sollen dementsprechend nicht nur die Diversität von Flora und Fauna fördern, sondern auch der Klimaerwärmung entgegenwirken.
Wie allgemein bekannt, wird der Klimawandel unsern Lebensraum nachhaltig verändern. Umweltspezialist Geri Kaufmann erläuterte zwei gängige, vom Bund angewandte Klimaprognosen für die Schweiz um 2100: Gemäss Szenario 1 steigt die durchschnittliche Jahrestemperatur gegenüber der Referenzperiode 1961–1990 um etwa 4,3 Grad (bis jetzt 1,8 Grad) an. Gleichzeitig werden ein Fünftel weniger Niederschläge erwartet. Weil diese vor allem Sommer fehlen, kann das zu Dürreperioden führen. Das weniger extreme Szenario 2 erwartet bis 2100 eine um 3,1 Grad höhere Jahrestemperatur gegenüber der Referenzzeit und nur etwa 2 Prozent weniger Sommerregen.
Fichten und Buchen weichen
So oder so werden sich ohne massive Gegenmassnahmen die Lebensräume der Flora und Fauna deutlich verschieben. Bereits muss man etwa Zecken neu bis 1500m und höher fürchten. Kaufmann schilderte, wie es den Fichten im Mittelland und im Jura zu warm und zu trocken werde. Eigentlich könnte die Waldgrenze steigen, doch müsse erst eine Periode mit Pionierpflanzen und –gehölzen in den höheren Lagen die Bodenbedingungen für Bäume schaffen. Ab etwa 2080 könnten sich auch die Buchen – jetzt klar konkurrenzstärkster Baum im Jura und im Mittelland – in höhere Lagen zurückziehen. Als Gegenmassnahme strebe die Forstwirtschaft bereits bewusst mehr Diversität an und unterstütze andere Bäume gegen die starke Konkurrenzkraft der Buchen, so Forstingenieur Kaufmann: «Wenn man die Natur machen lässt, setzt sich die stärkste Art durch – und das ist vielerorts noch immer die Buche.» Die für die Zukunft besser geeigneten Eichen seien allerdings frostempfindlich. «Trotz höheren Jahrestemperaturen kann es weiterhin Kälte und Schnee geben», betonte Kaufmann.
Übrigens: Die Jahresdurchschnittstemperatur während der letzten Eiszeit lag nur 3 Grad unter jener von 1961–1990! Beide erwähnten Szenarien für 2100 rechnen mit deutlich mehr als den 3 Grad Wärmezunahme, welche einst die mächtigen Eispanzer über weiten Teilen der Schweiz schmelzen liessen.
Anlassbericht als PDF Waldbegehung am Aeschisee_30.6.18.pdf (72 KB)
Bericht zum Thema aus dem Tagesanzeiger vom 09.07.2018 Es lebe das Moor!